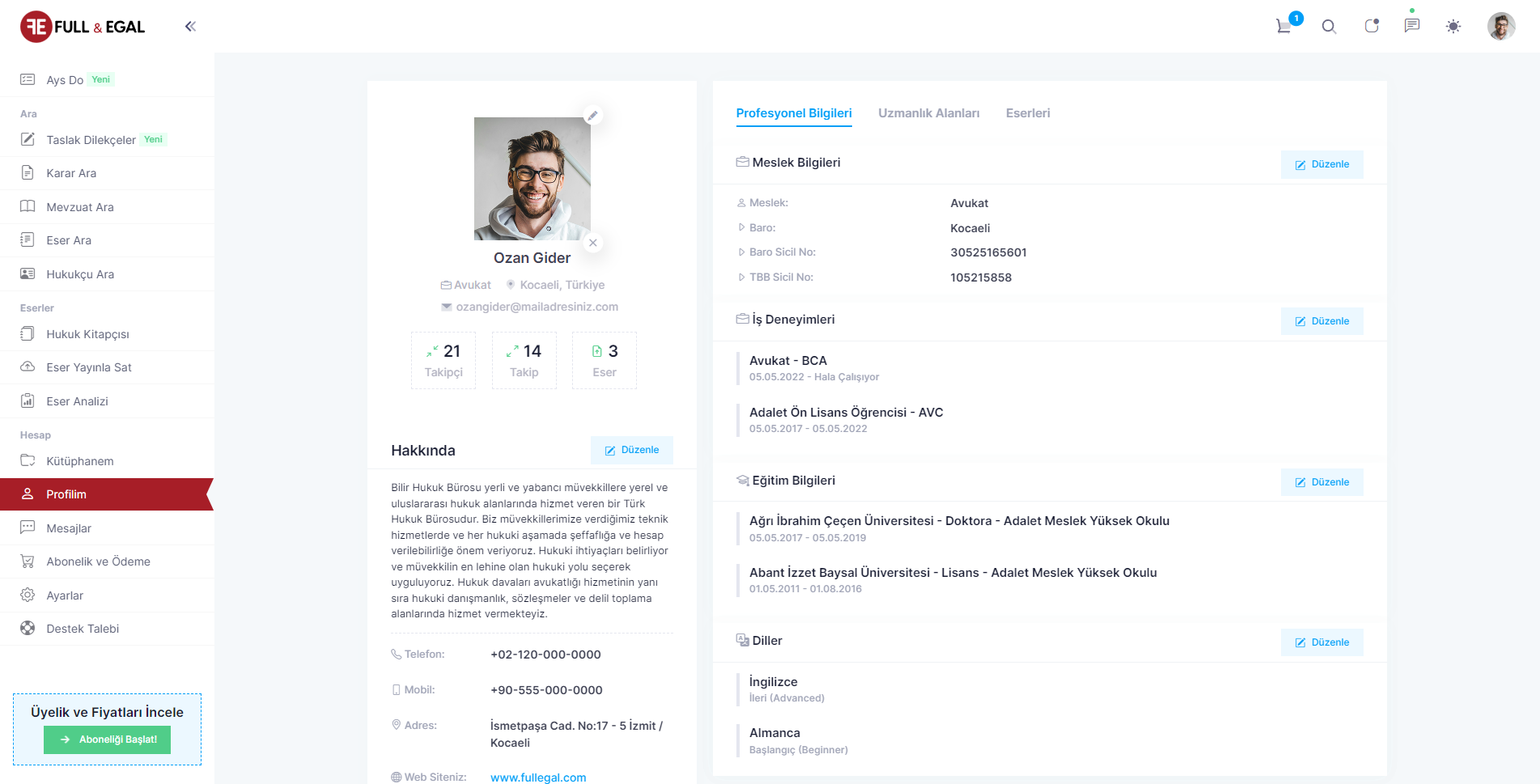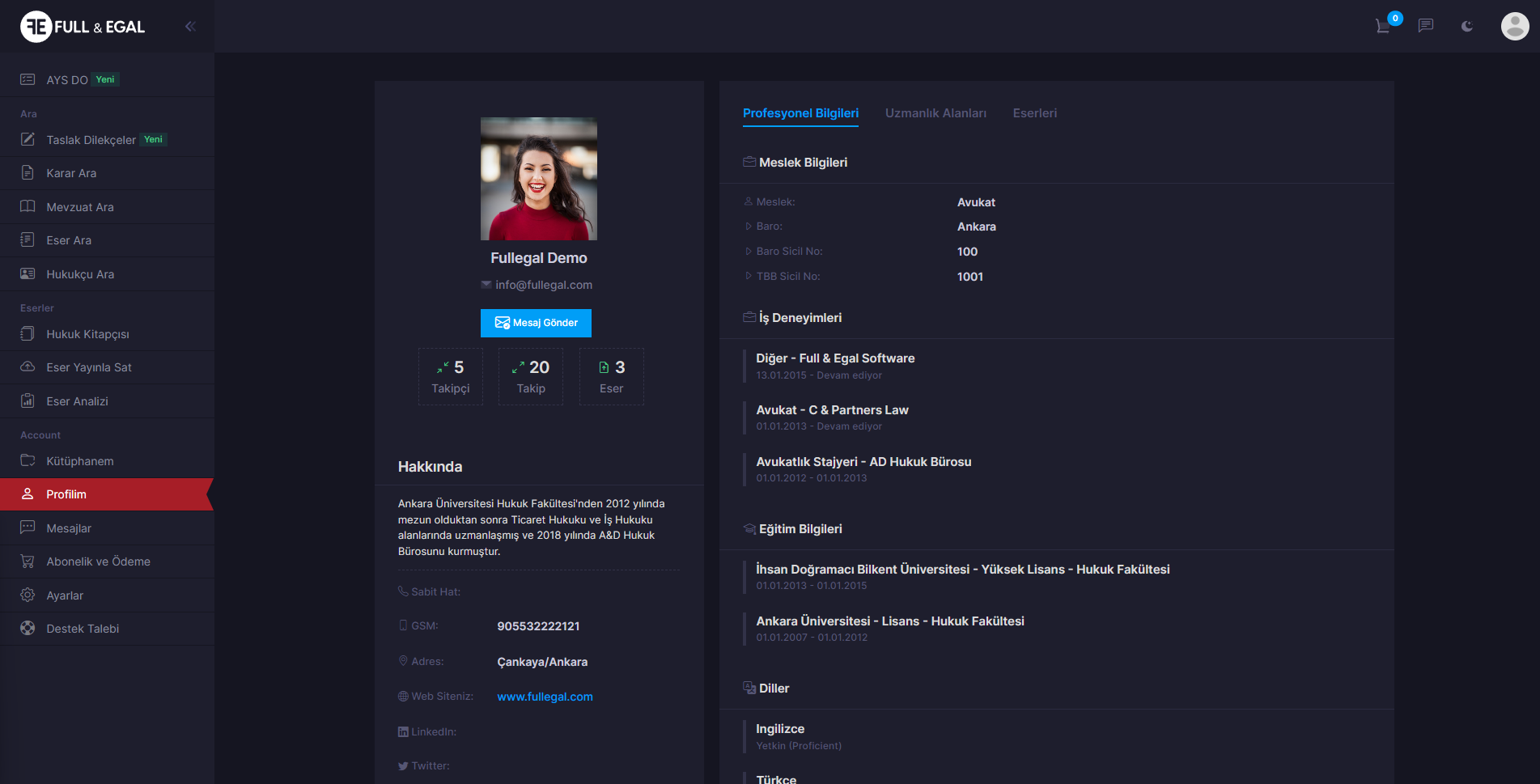BUNDESFINANZHOF Urteil vom 30.6.2010, II R 12/09
Beschränkung der Grundsteuerbefreiung auf korporierte Religionsgesellschaften und jüdische Kultusgemeinden verfassungsgemäß; Verfassungsmäßigkeit der Einheitsbewertung
Leitsätze
1. Die Beschränkung der Grundsteuerbefreiungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und § 4 Nr. 1 GrStG auf solche Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sowie auf jüdische Kultusgemeinden ist nicht verfassungswidrig .
2. Die Vorschriften über die Einheitsbewertung des Grundvermögens sind trotz der verfassungsrechtlichen Zweifel, die sich aus den lange zurückliegenden Hauptfeststellungszeitpunkten des 1. Januar 1964 bzw. --im Beitrittsgebiet-- des 1. Januar 1935 und darauf beruhenden Wertverzerrungen ergeben, jedenfalls für Stichtage bis zum 1. Januar 2007 noch verfassungsgemäß .
Tatbestand1 I. Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) ist ein rechtsfähiger Verein, der in Deutschland lebenden Menschen islamischen Glaubens die Möglichkeit zu ihrer Religionsausübung bietet. Nach seiner Satzung dient er ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung (AO).2 Der Kläger erwarb im Jahre 1994 ein in R gelegenes bebautes Grundstück. Das vorhandene Gebäude baute er um und errichtete einen Anbau.3 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) rechnete durch Bescheid vom 10. September 1998 das Grundstück dem Kläger zum 1. Januar 1995 zu und stellte ihm gegenüber durch weiteren, bestandskräftig gewordenen Bescheid vom 7. Dezember 1998 den Einheitswert im Wege der Wert- und Artfortschreibung auf den 1. Januar 1997 auf 411.800 DM sowie die Grundstücksart "gemischtgenutztes Grundstück" fest. Hierbei berücksichtigte das FA die baulichen Veränderungen sowie die teilweise Nutzung des Gebäudes zu gemeinnützigen Zwecken und die sich daraus ergebende (teilweise) Grundsteuerbefreiung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b des Grundsteuergesetzes (GrStG).4 Im Jahre 2006 bildete der Kläger aus zu Wohnzwecken genutzten Teilen des Gebäudes selbständiges Wohnungseigentum. Im selben Jahr ging beim FA eine Kontrollmitteilung ein, nach der der Kläger bereits ab 1997 nicht mehr ausschließlich gemeinnützig tätig war und deshalb die Voraussetzungen für die Grundsteuerbefreiung nicht erfüllte.5 Das FA schrieb daraufhin den Einheitswert für das Grundstück des Klägers durch Bescheid vom 9. Februar 2007 auf den 1. Januar 2007 fort und stellte diesen auf 235.807 EUR fest. Hierbei berücksichtigte es einerseits den Flächenabgang infolge der Bildung des Wohnungseigentums und andererseits auch den Wegfall der Grundsteuerbefreiung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b GrStG infolge der nicht mehr ausschließlich gemeinnützigen Tätigkeit des Klägers.6 Ferner stellte das FA mit Bescheid vom 14. Juni 2007 im Wege der Wertfortschreibung auf den 1. Januar 1998 unter Nichtberücksichtigung der bisher gewährten Steuerbefreiung wegen gemeinnütziger Nutzung des Grundstücks den Einheitswert auf 299.105 EUR (585.000 DM) fest. Dieser Bescheid ist Gegenstand des Revisionsverfahrens II R 13/09 und wurde durch heutiges Urteil des erkennenden Senats aufgehoben.7 Einspruch und Klage des Klägers gegen die Wertfortschreibung auf den 1. Januar 2007 vom 9. Februar 2007, mit denen der Kläger geltend machte, das Grundstück sei nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrStG von der Grundsteuer befreit, blieben erfolglos.8 Mit der Revision rügt der Kläger fehlerhafte Anwendung von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrStG.9 Der Kläger beantragt, die Vorentscheidung sowie den Einheitswertbescheid vom 9. Februar 2007 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 24. August 2007 aufzuheben.10 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe 11 II. Die Revision ist unbegründet und deswegen zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 12 1. Die Vorschriften über die Einheitsbewertung des Grundvermögens sind von der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) trotz der verfassungsrechtlichen Zweifel, die sich aus dem lange zurückliegenden Hauptfeststellungszeitpunkt (1. Januar 1964) und darauf beruhenden Wertverzerrungen ergeben, bislang als verfassungsgemäß beurteilt worden (BFH-Urteile vom 2. Februar 2005 II R 36/03, BFHE 209, 138, BStBl II 2005, 428; vom 21. Februar 2006 II R 31/04, BFH/NV 2006, 1450; vom 30. Juli 2008 II R 5/07, BFH/NV 2009, 7, und vom 4. Februar 2010 II R 1/09, BFH/NV 2010, 1244, m.w.N.). Daran ist jedenfalls noch für Stichtage bis zum 1. Januar 2007 festzuhalten. 13 Der Senat weist aber darauf hin, dass das weitere Unterbleiben einer allgemeinen Neubewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer mit verfassungsrechtlichen Anforderungen, insbesondere mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes --GG--), nicht vereinbar ist. Das System der Hauptfeststellung auf einen bestimmten Stichtag ist darauf angelegt, dass Hauptfeststellungen in bestimmten, nicht übermäßig langen Abständen stattfinden (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 des Bewertungsgesetzes --BewG--: Hauptfeststellungen in Zeitabständen von je sechs Jahren). Die Festschreibung der Wertverhältnisse auf den Hauptfeststellungszeitpunkt ist nur sachgerecht und aus verfassungsrechtlicher Sicht hinnehmbar, wenn der Hauptfeststellungszeitraum eine angemessene Dauer nicht überschreitet (s. bereits BFH-Beschluss vom 11. Juni 1986 II B 49/83, BFHE 146, 474, BStBl II 1986, 782; Drosdzol, Deutsche Steuer-Zeitung 1999, 831, 832, und 2001, 689, 691; Dötsch in Gürsching/Stenger, Bewertungsrecht, Einf. BewG Rz 110; Thöne in Lange, Reform der Gemeindesteuern, 2006, 173, 175 f.; Seer in Tipke/Lang, Steuerrecht, 20. Aufl., § 13 Rz 210 f.). 14 a) Der dem Gesetzgeber im Bereich des Steuerrechts zukommende weit reichende Entscheidungsspielraum wird vor allem durch zwei eng miteinander verbundene Leitlinien begrenzt: durch die Ausrichtung der Steuerlast an den Prinzipien der finanziellen Leistungsfähigkeit und der Folgerichtigkeit (Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 4. Dezember 2002 2 BvR 400/98 und 1735/00, BVerfGE 107, 27, BStBl II 2003, 534, unter C.I.1.a und b; vom 7. November 2006 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, BStBl II 2007, 192, unter C.I.1. und 2., und vom 15. Januar 2008 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, unter C.I.2.a aa, je m.w.N.). Knüpft die Besteuerung an die Werte von Wirtschaftsgütern an, müssen Bemessungsgrundlagen gefunden werden, die deren Werte in ihrer Relation realitätsgerecht abbilden (BVerfG-Beschlüsse vom 22. Juni 1995 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, BStBl II 1995, 655, unter C.II.2.; vom 22. Juni 1995 2 BvR 552/91, BVerfGE 93, 165, BStBl II 1995, 671, unter C.II.1., und in BVerfGE 117, 1, BStBl II 2007, 192, unter C.I.3.b aa, m.w.N.). 15 b) Das BVerfG hat im Hinblick auf diese verfassungsrechtlichen Anforderungen im Beschluss in BVerfGE 117, 1, BStBl II 2007, 192, unter C.II.2.f bb, die durch § 138 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4, § 145 Abs. 3 Satz 2 BewG a.F. für die Bedarfsbewertung unbebauter Grundstücke angeordnete, bis Ende 2006 geltende Festschreibung der Wertverhältnisse auf den 1. Januar 1996 als nicht mehr mit den Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar angesehen. Der Gesetzgeber habe damit den aus dem Gleichheitssatz folgenden verfassungsrechtlichen Auftrag verfehlt, die Vermögensgegenstände mit Gegenwartswerten zu erfassen oder vergangenheitsbezogene Werte entwicklungsbegleitend fortzuschreiben, um eine in der Relation der Vermögenswerte realitätsgerechte Bewertung sicherzustellen. 16 c) Hiernach verfehlt erst recht die über mehr als vier Jahrzehnte unveränderte Einheitsbewertung des Grundbesitzes nach Maßgabe des Hauptfeststellungszeitpunkts auf den 1. Januar 1964 die sich aus Art. 3 Abs. 1 GG ergebenden Anforderungen. 17 Als Grundlage für die Bemessung der Grundsteuer bedarf es auch innerhalb der Vermögensgruppe des Grundvermögens einer realitätsgerechten Bewertung. Es stellt sich hier zwar --anders als bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer-- nicht das Problem der Gleichbehandlung mit anderen Gegenständen, die mit dem Verkehrswert (§ 9 BewG) angesetzt werden. Aber auch innerhalb des Grundvermögens können aus verfassungsrechtlichen Gründen auf einem übermäßig langen Hauptfeststellungszeitraum beruhende Wertverzerrungen nicht uneingeschränkt hingenommen werden. Dem steht nicht entgegen, dass für die Bemessung der Grundsteuer nicht nur die festgestellten Einheitswerte, sondern auch die von den Gemeinden nach § 25 GrStG festgesetzten Hebesätze maßgebend sind; denn aufgrund eines übermäßig langen Hauptfeststellungszeitraums kann es auch innerhalb des jeweiligen Gemeindegebiets zu einer deutlich unterschiedlichen Entwicklung der Wertverhältnisse kommen, die nicht auf bei der Einheitsbewertung zu berücksichtigenden Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse (§ 22 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 BewG), sondern auf unterschiedlichen Änderungen der Wertverhältnisse in einzelnen Gemeindeteilen beruhen und nach § 27 BewG bei Fortschreibungen und bei Nachfeststellungen der Einheitswerte nicht zugrunde zu legen sind. 18 d) Angesichts dieser verfassungsrechtlichen Bindungen der Einheitsbewertung erscheint es zweifelhaft, ob --wie noch im BFH-Urteil in BFHE 209, 138, BStBl II 2005, 428 angenommen-- für die im Ertragswertverfahren festgestellten Einheitswerte ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG deshalb verneint werden kann, weil diese Werte erheblich unter dem gemeinen Wert liegen. Für die Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG könnte vielmehr sprechen, dass die im Ertragswertverfahren und im Sachwertverfahren ermittelten Einheitswerte zueinander auch nicht annähernd in einem den tatsächlichen Wertverhältnissen entsprechenden Verhältnis stehen (so bereits BFH-Urteil in BFHE 146, 474, BStBl II 1986, 782). Für das Ertragswertverfahren ist auch zu berücksichtigen, dass den Wertverhältnissen im Jahr 1964 preisgestoppte Mieten zugrunde lagen; diese preisrechtlichen Bindungen sind jedoch seit langem entfallen (BFH-Urteil in BFHE 146, 474, BStBl II 1986, 782). 19 Die mehrere Jahrzehnte umfassende Dauer des Hauptfeststellungszeitraums führt zudem bei der Bewertung von Gebäuden im Sachwertverfahren zu einer Verletzung des verfassungsrechtlichen Gebots einer folgerichtigen Gesetzgebung. Aufgrund der Entwicklung des Bauwesens gibt es eine immer größere Zahl von Gebäuden, die sich nach Bauart, Bauweise, Konstruktion oder Objektgröße von den im Jahr 1958, dessen Baupreisverhältnisse für die Einheitsbewertung maßgeblich sind (§ 85 Satz 1 BewG), vorhandenen Gebäuden so sehr unterscheiden, dass ihre Bewertung nicht mehr mit einer verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechenden Genauigkeit und Überprüfbarkeit möglich ist. Für derartige neue Gebäude ist ein Vergleich mit den Herstellungskosten für bereits im Jahr 1958 bestehende entsprechende Gebäude nicht möglich. Eine Schätzung, wie viel die Errichtung neuartiger Gebäude im Jahr 1958 gekostet hätte, wenn es damals bereits solche Gebäude gegeben hätte, kann nur zu mehr oder minder richtigen Näherungswerten führen. 20 Auf unbegrenzte Dauer ist es auch nicht hinnehmbar, dass eine Wertminderung wegen Alters nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt gemäß § 85 Satz 3 i.V.m. § 86 BewG ausgeschlossen ist. 21 e) Das jahrzehntelange Unterlassen einer erneuten Grundstücksbewertung führt darüber hinaus zwangsläufig zu verfassungsrechtlich nicht mehr hinnehmbaren Defiziten beim Gesetzesvollzug. Ohne eine in regelmäßigen Abständen erfolgende Neubewertung sämtlicher der Einheitsbewertung unterliegender Objekte ist nicht sichergestellt, dass Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, die Wertänderungen bewirken und zu Fortschreibungen nach § 22 BewG führen müssten, im Sinne des erforderlichen gleichmäßigen Gesetzesvollzugs durchgehend erfasst werden. Umstände, die eine Fortschreibung auslösen können, werden den Finanzämtern oft nur von dritter Seite mitgeteilt. Meistens erhalten die Finanzämter die Mitteilung über den Grund für eine Fortschreibung erst nach längerer Zeit. § 22 Abs. 4 Satz 1 BewG verpflichtet die Finanzämter nicht, stets von sich aus tätig zu werden. Die Ermittlungspflicht der Finanzämter setzt vielmehr erst ein, wenn ihnen Umstände bekannt werden, die eine Fortschreibung rechtfertigen könnten (Halaczinsky in Rössler/Troll, BewG, § 22 Rz 66; Bruschke in Gürsching/ Stenger, Bewertungsrecht, § 22 BewG Rz 219). 22 f) Verfassungsrechtlich geboten ist eine erneute Hauptfeststellung auch im Beitrittsgebiet. Insoweit können die in §§ 129 ff. BewG getroffenen Regelungen künftig wegen der inzwischen verstrichenen Zeit nicht mehr --wie seinerzeit noch vom BFH (z.B. Beschluss vom 12. Januar 2006 II B 56/05, BFH/NV 2006, 919) angenommen-- mit Übergangsschwierigkeiten nach der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands gerechtfertigt werden. Da im Beitrittsgebiet die Wertverhältnisse auf den 1. Januar 1935 festgeschrieben sind (§ 129 BewG), wiegen die hiergegen bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken nach Ablauf einer angemessenen Übergangszeit noch schwerer als im alten Bundesgebiet. Seit dem 1. Januar 1935 haben sich die für die Bewertung maßgeblichen Verhältnisse noch wesentlich stärker entwickelt und verändert als seit dem 1. Januar 1964. 23 2. Das Finanzgericht (FG) ist bei seiner Entscheidung zutreffend davon ausgegangen, dass das FA den Einheitswert für das Grundstück des Klägers nach § 22 BewG auf den 1. Januar 2007 fortschreiben konnte. 24 a) Nach § 22 Abs. 1 BewG findet wegen Änderung der tatsächlichen Verhältnisse eine Wertfortschreibung statt, wenn der nach § 30 BewG abgerundete Wert, der sich für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt, vom Einheitswert des letzten Feststellungszeitpunkts in einem näher beschriebenen Ausmaß nach oben oder unten abweicht. Eine Wertfortschreibung findet nach § 22 Abs. 3 BewG auch zur Beseitigung eines Fehlers der letzten Feststellung statt. Die Fortschreibung ist vorzunehmen, wenn der Finanzbehörde bekannt wird, dass die Voraussetzungen für sie vorliegen (§ 22 Abs. 4 Satz 1 BewG). 25 b) Der Fortschreibungszeitpunkt ist in § 22 Abs. 4 Satz 3 BewG je nach dem Anlass der Fortschreibung unterschiedlich geregelt. Bei einer Fortschreibung wegen Änderung der tatsächlichen Verhältnisse ist Fortschreibungszeitpunkt der Beginn des Kalenderjahres, das auf die Änderung folgt (§ 22 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 BewG). Liegt der Grund zur Fortschreibung nicht in einer Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, sondern in einem Fehler bei der vorangegangenen Feststellung (§ 22 Abs. 3 Satz 1 BewG), so ist Fortschreibungszeitpunkt grundsätzlich der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Fehler dem FA bekannt wird (§ 22 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 1. Alternative BewG), bei einer Erhöhung des Einheitswerts jedoch frühestens der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Feststellungsbescheid erteilt wird (§ 22 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 2. Alternative BewG). 26 c) Im Streitfall kann offen bleiben, ob und in welchem Umfang der Wertfortschreibungsbescheid vom 9. Februar 2007 geänderten tatsächlichen Verhältnissen Rechnung trägt oder lediglich einen Rechtsfehler der letzten Feststellung beseitigt. Denn die Wertfortschreibung erfolgte auf den Beginn des Kalenderjahres, in dem der Feststellungsbescheid erteilt wurde und damit in jedem Fall auf einen zulässigen Fortschreibungszeitpunkt. Auch die Wertfortschreibungsgrenzen sind erreicht. 27 3. Das FG ist ohne Rechtsverstoß davon ausgegangen, dass § 19 Abs. 4 BewG der Feststellung des Einheitswerts nicht entgegenstand. Danach dürfen Feststellungen nur dann erfolgen, wenn und soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind. Entgegen der Auffassung des Klägers ist die Feststellung des Einheitswerts im Streitfall für die Grundsteuer von Bedeutung. Denn der Grundbesitz des Klägers ist nicht nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 oder § 4 Nr. 1 GrStG grundsteuerbefreit. Die behauptete Grundsteuerbefreiung kann im Verfahren gegen den Einheitswertbescheid geprüft werden (BFH-Urteile vom 24. Juli 1985 II R 227/82, BFHE 144, 201, BStBl II 1986, 128; vom 10. Juli 2002 II R 22/00, BFH/NV 2003, 202). 28 a) Von der Grundsteuer befreit ist gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrStG der Grundbesitz, der von einer Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, einem ihrer Orden, einer ihrer religiösen Genossenschaften oder einem ihrer Verbände für Zwecke der religiösen Unterweisung, der Wissenschaft, des Unterrichts, der Erziehung oder für Zwecke der eigenen Verwaltung genutzt wird. Den Religionsgemeinschaften stehen nach Satz 2 der Vorschrift die jüdischen Kultusgemeinden gleich, die nicht Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Nach § 4 Nr. 1 GrStG unterliegt ferner solcher Grundbesitz nicht der Grundsteuer, der, sofern er nicht nach § 3 GrStG steuerbefreit ist, dem Gottesdienst einer Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, oder einer jüdischen Kultusgemeinde gewidmet ist. 29 aa) Es bedarf für den Streitfall keiner Entscheidung, ob und unter welchen Voraussetzungen dem Gottesdienst gewidmeter Grundbesitz nicht nach § 4 Nr. 1 GrStG, sondern bereits gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrStG befreit sein kann (dazu Troll/Eisele, Grundsteuergesetz, Kommentar, 9. Aufl., § 3 Rz 55). Jedenfalls erfüllt der Kläger auch dann, wenn er eine Religionsgemeinschaft im Sinne dieser Vorschriften sein sollte, die darin bestimmten Befreiungsvoraussetzungen deshalb nicht, weil er weder den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzt noch eine jüdische Kultusgemeinschaft ist. 30 bb) Nach dem Wortlaut des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und § 4 Nr. 1 GrStG ist ausschließlich entscheidend, ob der Kläger den Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft (Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 5 der Weimarer Reichsverfassung --WRV--) hat. Die Befreiungsvoraussetzungen sind erst nach Ergehen eines entsprechenden Verleihungsakts (dazu z.B. P. Kirchhof in Handbuch des Staatskirchenrechts --HdbStKR--, Bd. 1, 1994, § 22 S. 686; vgl. auch Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 8 WRV), an dem es im Streitfall fehlt, erfüllt. Ob der Kläger einen solchen Status erhalten kann und will, ist hingegen unerheblich. Abgesehen davon, dass der Kläger nach seinem Vorbringen einen solchen Rechtsstatus ersichtlich nicht anstrebt, reicht die bloße Möglichkeit zur Erlangung des Körperschaftsstatus für die Gewährung einer Grundsteuerbefreiung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 oder § 4 Nr. 1 GrStG nicht aus (vgl. auch BFH-Urteil vom 6. Juni 1951 III 69/51 U, BFHE 55, 376, BStBl III 1951, 148). 31 b) Die Beschränkung der Grundsteuerbefreiung auf Religionsgemeinschaften, die Körpe